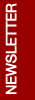Fachbeitrag für die Wirtschaftszeitung der Rhein-Zeitung Ausgabe April 2020
Finanzierungsmöglichkeiten und steuerliche Betrachtung von gewerblichen PV-Anlagen
Erneuerbare Energien sind eine Frage des Flächenangebotes. Die Dächer von rund 3,3 Millionen Betrieben bieten hierzulande reichlich Platz für Photovoltaikanlagen. Insgesamt 1,7 Millionen solcher Anlagen erzeugen in Deutschland aktuell Strom aus Sonnenlicht. Für Gewerbe- und Industriebetriebe lohnt sich die Investition in Solarstrom. „Es gibt viele Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten“, so Andre Steffens, Co-Geschäftsführer der Wi SOLAR GmbH aus Kaisersesch. So bietet die KfW-Bank gewerblichen Investoren Darlehen mit langfristiger Zinsbindung auf niedrigem Niveau an. Die meisten Gewerbekunden werden anhand ihrer Bonität in die Risikostufe B eingeordnet und dürfen mit einem effektiven Jahreszins von 1,43% bei hundertprozentiger Auszahlung rechnen. Das Angebot ist mit weiteren Förder- und Finanzierungsprogrammen kombinierbar. „Die Beantragung und Auszahlung erfolgt über die Hausbanken, die ihrerseits weitere Finanzierungsangebote für gewerbliche PV-Kunden bereithalten“, so Sebastian Weber, Unternehmens-kundenbetreuer von der Sparkasse Koblenz. Vorteilhaft für die Kreditvergabe ist, dass garantierte Einspeisevergütungen bzw. das Marktprämienmodell sowie Einsparungen beim Stromkauf bereits eine Sicherheitsleistung darstellen. Bei entsprechender Anlagengröße, Stromverbrauch und Branche kann auch durch Einsatz von Eigenkapital eine attraktive Rendite erzielt werden. Gleichwohl entscheiden sich manche Unternehmer aber bewusst gegen einen Kauf und ziehen die Möglichkeiten von Pacht und Leasing vor.

Leasing & Pacht: Die clevere Alternative
Die Vorteile von gewerblicher Pacht und Leasing liegen zunächst einmal auf der Hand: „Der Anlagenbetreiber schließt mit einem Leasinggeber wie z. B. uns einen Leasingvertrag ab. Für Wartung und Service wird dann eine zusätzliche Vereinbarung mit einem PV-Experten wie der Wi SOLAR abgeschlossen“, erläutert Sven Scaruppe von der MMV Leasing in Koblenz. Bei einer Anlagenpacht verhält es sich ähnlich. „Das unternehmerische Risiko muss beim Anlagenbetreiber liegen, ansonsten besteht die Gefahr, dass die volle EEG-Abgabe gezahlt werden muss. Bei einem Eigenverbrauch fallen nur 40% an“, sagt Andre Steffens. Die Laufzeit für ein Anlagenleasing variiert je nach Anbieter und beträgt bei der MMV beispielsweise acht Jahre. Die Dauer einer Pacht wird zwischen Betreiber und Verpächter ausgehandelt. Auch lange Laufzeiten von bis zu 20 Jahren sind denkbar: „Vorteilhaft ist dabei die lange Planungssicherheit“, so der Co-Geschäftsführer der Wi SOLAR Sven Endris. Unternehmen mit einer großen Dachfläche und einem langfristig kalkulierbaren Stromverbrauch erzielen mit einem Eigenerwerb aber größtmögliche Unabhängigkeit. Vor dem EEG wird ein Pächter oder Leasingnehmer genauso behandelt wie ein Eigentümer. Welches Modell im Einzelfall sinnvoll ist, kann im Rahmen eines Beratungsgesprächs bei der Wi SOLAR GmbH geklärt werden.

Zahlreiche Möglichkeiten zur steuerlichen Geltendmachung
Unternehmer können alle Ausgaben im Zusammenhang mit einer PV-Anlage steuerlich geltend machen, z. B. Investitionskosten, Betriebs- und Wartungsausgaben sowie Kreditzinsen und Versicherungen. „Direkt nach der Anschaffung erhält der Unternehmer die im Zusammenhang mit der Investition gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt rückerstattet“, so Steuerberaterin Iris Steinacker-Creutzfeldt. Seit 2008 besteht für kleine und mittlere Betriebe, die aktiv am wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen und eine in diesem Sinne werbende Tätigkeit ausüben, die Option, ein bis drei Jahre vor der Anschaffung einer PV-Anlage einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag geltend zu machen. Die Höhe beträgt dabei bis zu 40% der voraussichtlichen Anschaffungskosten. Zudem besteht für diese Betriebe die Möglichkeit, neben der linearen Abschreibung auf die Anschaffungskosten bei einer 20-jährigen Nutzungszeit mit jährlich 5%, Sonderabschreibungen im Jahr der Anschaffung und in den vier folgenden Jahren von bis zu 20% der Anschaffungskosten in Anspruch zu nehmen. „Die durch den Betrieb der Anlage stattfindende Wertminderung kann als Aufwand steuermindernd, z. B. bei der Einkommenssteuer, angesetzt werden“, so Steinacker-Creutzfeldt.

Eigennutzung und Einspeisung
Gewerbe- und Industriebetriebe weisen häufig dann einen konstanten Stromverbrauch (u. a. durch Produktionsanlagen, Beleuchtungen, Klimaanlagen und Computer) auf, wenn durch Sonneneinstrahlung viel Energie erzeugt wird. Das schafft zweifache Sicherheit: Der Grad an Eigennutzung ist kalkulierbar, gleichzeitig kann überschüssiger Strom ins Netz eingespeist werden. Marktprämie und Einspeisevergütung werden ab dem Tag des Betriebsbeginns für 20 Jahre plus des Jahres der Inbetriebnahme festgesetzt. „Für Unternehmen bedeutet eine PV-Anlage maximale Kalkulationssicherheit“, erklärt Endris. Liegt der Verbrauchspeak (wie bei gewerblichen Anlagennutzern häufig) zwischen 8 und 18 Uhr, sind Eigenverbrauchsquoten von entrichtenden EEG-Umlage für den Eigenverbrauch, entsteht nach der aktuellen Preislage ein Gewinn von rund 7 Cent/kWh. „Eine gewerblich genutzte PV-Anlage lohnt sich vom ersten Tag an“, so Steffens. über 70% keine Seltenheit. Der Zukauf von Netzstrom reduziert sich deutlich. Aus der Differenz zwischen Einkaufspreis und Stromgestehungskosten, abzüglich der anteilig zu entrichtenden EEG-Umlage für den Eigenverbrauch, entsteht nach der aktuellen Preislage ein Gewinn von rund 7 Cent/kWh. „Eine gewerblich genutzte PV-Anlage lohnt sich vom ersten Tag an“, so Steffens.
Steuerliche Angelegenheiten bei der Netzeinspeisung
Die meisten gewerblichen Anlagennutzer sind keine reinen Eigenverbraucher. Das Bundesfinanzministerium stellt hierzu fest: „Umsatzsteuerpflichtig ist, wer den erzeugten Strom ganz oder teilweise, regelmäßig und nicht nur gelegentlich in das allgemeine Stromnetz einspeist“. Die Abrechnung erfolgt durch den Netzbetreiber als Gutschrift. Der Betreiber hat hier keinen Aufwand, z. B. durch Rechnungsstellung. Er muss lediglich die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. „Darüber hinaus sind Gewinne aus der Anlage in Form von Einkommens- bzw. Körperschaftsteuer (bei GmbHs) zu versteuern. Die Gewerbesteuerpflicht bemisst sich aus dem Gesamtertrag des Unternehmens, zu dem der Gewinn aus einer PV-Anlage nur partiell beiträgt“, erläutert Steuerexpertin Iris Steinacker-Creutzfeldt. Wird die PV-Anlage auf dem Dach montiert und gilt damit als sog. Betriebsvorrichtung, entfällt beim Kaufpreis die Grunderwerbssteuer. Auch bei der umweltfreundlichen Sonnenenergie gibt es also steuerlich einige Besonderheiten. „Davon sollte man sich aber keinesfalls abschrecken lassen“, sagt Experte Sven Endris.